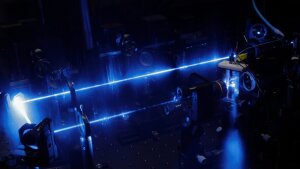Ticker
Dr. Barbara Schmidt mit einem elektrischen Handdynamometer vor dem Universitätsklinikum Jena
Foto: UKJWie mentales Training wirkt
Den Einfluss von Hypnose auf die körperliche Leistungsfähigkeit von Menschen, hat Psychologin Dr. Barbara Schmidt (Foto) vom Universitätsklinikum Jena untersucht und ihre Studie im Fachmagazin »Scientific Reports« veröffentlicht (DOI: 10.1038/s41598-024-73117-0Externer Link).
Darin konnte sie zeigen, dass mit Hilfe von Hypnose nicht nur das subjektive Stärkegefühl gesteigert werden kann, sondern auch die objektiv messbare Stärke – und das mit langanhaltender Wirkung, diese war auch nach einer Woche noch messbar. Die Tests hat Barbara Schmidt an Profi-Biathletinnen und -athleten am Olympiastützpunkt im Schwarzwald durchgeführt. Ihre Erkenntnisse lassen sich sowohl für den Leistungssport als auch für den Genesungsprozess von Patientinnen und Patienten nutzen. [Bogner]
Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella) umgeben von braunem Laub
Foto: Petr HarantGo west
Die Verbreitung europäischer Waldpflanzen verschiebt sich nach Westen. Stickstoffeinträge sind dafür die Hauptursache. Dies sind die Ergebnisse einer in der Zeitschrift »Science« veröffentlichten Studie (DOI: 10.1126/science.ado0878Externer Link), an der drei Forschende des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) beteiligt waren, darunter apl. Prof. Dr. Markus Bernhardt-Römermann von der Uni Jena. So wandert etwa der Wald-Sauerklee Oxalis acetosella (Foto) knapp fünf Kilometer pro Jahr nach Westen und etwa 0,1 Kilometern pro Jahr nach Norden.
Die Studienergebnisse widersprechen der Annahme, dass hauptsächlich der Klimawandel für die Verschiebung der Artenverbreitung verantwortlich sei und werfen damit ein neues Licht auf die Frage, wie Umweltfaktoren die Artenvielfalt verändern. [Hahn]
In der Nähe von Saalfeld ausgegrabene Zehenknochen vom Pferd mit durch Feuersteinmesser entstandenen Schnittmarken
Foto: W. MüllerKnochenfunde aus der Altsteinzeit
Ein Forschungsteam der Universitäten Jena und Neuchâtel, zu dem auch der Jenaer Prähistoriker Prof. Dr. Clemens Pasda gehört, hat altsteinzeitliche Tierknochenfunde, die in den 1970er Jahren in der Nähe von Saalfeld ausgegraben wurden, erneut ausgewertet, darunter Zehenknochen vom Pferd mit durch Feuersteinmesser entstandenen Schnittmarken (Foto).
Die Funde stammen aus dem sogenannten Magdalénien – einer Kultur, die vor etwa 20 000 Jahren begann und rund 6 000 Jahre dauerte. Die neu gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die These, dass in dieser Zeit die Menschen nicht in größeren Camps lebten, von denen aus Jagdexpeditionen starteten und wieder dorthin zurückkehrten, sondern dass sie in kleinen mobilen Gruppen umherzogen und dabei den Spuren der nächsten Beute folgten (DOI: 10.7485/qu.2023.70.108128Externer Link). [sh]
Teilnehmende beim Abschlusstreffen der Mitteldeutschen Sepsiskohorte am Universitätsklinikum Jena
Foto: Michael SzabóLangzeitfolgen von Sepsis
Seit 2016 hat ein Studienteam um Prof. Dr. André Scherag am Universitätsklinikum Jena über 3 000 Sepsis-Überlebende nach ihrem Gesundheitszustand befragt und die Ergebnisse in der Fachzeitschrift »The Lancet Regional Health – Europe« veröffentlicht (DOI: 10.1016/j.lanepe.2024.101066Externer Link).
Die Studie belegt großen Bedarf an interdisziplinären Nachsorgeangeboten. So litten fast alle Sepsis-Überlebenden an Folgeerkrankungen: 90 Prozent haben körperliche Einschränkungen. Sechs von zehn beklagen Gedächtnisstörungen und bei vier von zehn traten psychische Folgen ein. Häufig leiden Betroffene an mehreren Folgeerkrankungen gleichzeitig. Zuvor unabhängige Patientinnen und Patienten haben gute Chancen, diese Selbstständigkeit zu bewahren. Insgesamt kehrt jedoch nur etwa ein Drittel der Sepsis-Überlebenden in die Unabhängigkeit zurück. [vdG]
Ein Crew-Mitglied des Forschungsseglers »Tara« sammelt einzellige Mikroalgen aus dem Meer.
Foto: Samues Bollendorff/Fondation Tara OcéanForever young
Ein Team des Exzellenzclusters »Balance of the Microverse« der Uni Jena um Dr. Yun Deng sowie Prof. Dr. Georg Pohnert vom Institut für Anorganische und Analytische Chemie, hat einen Verjüngungsmechanismus bei Einzellern entdeckt. Die Forschenden untersuchten Mikroalgen, die in den Ozeanen als Grundlage der Nahrungsketten dienen.
Auch Einzeller altern, wenn sie sich wegen Nährstoffmangels nicht mehr teilen können. Der Mechanismus ermöglicht es alten Zellen, sich zu verjüngen und wieder zu teilen, nachdem sie in nährstoffreiche Gebiete gelangen. Die Ergebnisse der Studie könnten weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der Zellalterung und -regeneration in marinen Ökosystemen haben. Die Studie wurde in »Nature Microbiology« veröffentlicht (DOI: 10.1038/s41564-024-01746-2Externer Link). [Seeber]
Ein Laseraufbau am Leibniz-Institut für Photonische Technologien
Foto: Sven DöringGrundlagen für nachhaltige Energie
Forschende aus Jena und Ulm haben einen Ansatz entwickelt, um die Eigenschaften von lichtabsorbierenden Materialien (Chromophoren) zu beeinflussen. Chromophore sind Moleküle, die Licht absorbieren und die aufgenommene Energie beispielsweise in einem Elektronentransfer wieder abgeben können. Die Fähigkeit der Chromophore, nach Lichtabsorption Elektronen auf einen Reaktionspartner zu übertragen, ist von großer Relevanz, insbesondere in der Photokatalyse und der Photovoltaik.
Das Forschungsteam um Prof. Dr. Benjamin Dietzek-Ivanšić vom Sonderforschungsbereich CataLight hat an Eisenverbindungen demonstriert, dass ihre Eigenschaften durch chemische Modifikationen gesteuert werden können. Die Studie ist im »Journal of the American Chemical Society« erschienen (DOI: 10.1021/jacs.4c00552Externer Link). [Meier-Ewert]
Künstlerische Visualisierung: Umwandlung von Lichteigenschaften durch 2D Meta-Materialien
Illustration: Christian Süß/Fraunhofer-IOFDurchbruch in der Quantenoptik
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Maximilian Weißflog vom Institut für Angewandte Physik hat einen bedeutenden Fortschritt in der Quantenoptik erzielt. In einer Veröffentlichung im Magazin »Nature Communications« präsentiert das Team eine neuartige Methode zur Erzeugung von verschränkten Photonenpaaren mit Hilfe von zweidimensionalen (2D) Materialien (DOI: 10.1038/s41467-024-51843-3Externer Link). Diese Entwicklung könnte die Tür zur Quantenverschlüsselung auf mobilen Geräten weit aufstoßen. Die vorgestellte Quelle für verschränkte Photonenpaare ist bemerkenswert klein: Mit einer Größe von lediglich 10 x 10 x 10 Mikrometern (μm) lässt sie sich problemlos in kompakte Geräte integrieren. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Quellen für verschränkte Photonen, die oft sperrig und komplex in der Handhabung sind. [Winkler]
Prof. Dr. Christian Jogler und Doktorandin Carmen Elisabeth Wurzbacher mit einem Erlenmeyerkolben und dem darin befindlichen Bakterium Planctopirus Limnophila
Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Bakterien auf Beutezug
Ein Forschungsteam um Prof. Dr. Christian Jogler (Foto, r.) hat Einzeller entdeckt, die es nach bisheriger Lehrmeinung gar nicht geben sollte. In einer im Magazin »mBio« vorgestellten Publikation zeigen die Forschenden, dass prokaryotische Bakterien der Art Uabimicrobium helgolandensis in der Lage sind, andere Einzeller zu »fressen« (DOI: 10.1128/mbio.02044-24Externer Link).
Das Ergebnis dieser Endozytose ist ein Mischwesen aus zwei prokaryotischen Zellen, die als eine Art Vorläufer für eukaryotische Zellen höherer Organismen angesehen werden kann. Damit widerlegt das Team die Lehrmeinung, nach der es als energetisch unmöglich galt, dass prokaryotische Zellen zur Endozytose in der Lage sind. Anders als eukaryotische Zellen, die einen Zellkern und Mitochondrien besitzen, die die Zellen mit Energie versorgen, fehlen Prokaryoten diese Zellkraftwerke. [MK]