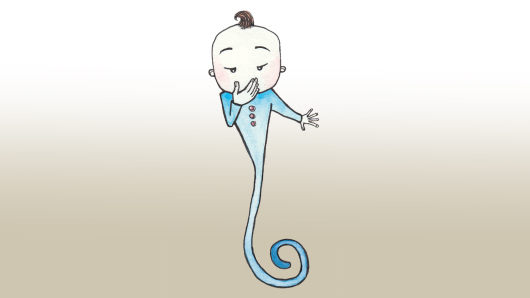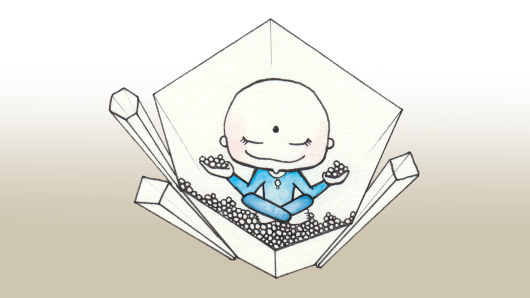Von wegen mikroskopisch klein
Nicht alle Mikroorganismen sind für das bloße Auge unsichtbar. Die bisher größte bekannte Bakterienart Thiomargarita magnifica trägt ihren Namen mit Fug und Recht: Während durchschnittliche Bakterien rund einen Mikrometer (ein Tausendstel Millimeter) klein sind, weist dieser fadenförmige Einzeller, der im Wasser karibischer Mangrovenwälder zu finden ist, bis zu stattlichen zwei Zentimeter Länge auf. [1]
Meister der Extreme
Fakten über außergewöhnliche Mikroorganismen
- [1] Von wegen mikroskopisch kleinExterner Linken
- [2] StaatsmikrobenExterner Linken
- [3] Mikroorganismen sind GroßproduzentenExterner Linken
- [4] Mikroorganismen sind GroßproduzentenExterner Link
- [5] Acht Prozent des menschlichen Genoms stammt von VirenExterner Linken
- [6] Acht Prozent des menschlichen Genoms stammt von VirenExterner Linken
- [7] Zeitzeugen der DinosaurierExterner Linken
- [8] Zeitzeugen der DinosaurierExterner Linken
- [9] Leben an lebensfeindlichen OrtenExterner Linken
- [10] Leben an lebensfeindlichen OrtenExterner Linken
- [11] Leben an lebensfeindlichen OrtenExterner Link
- [12] Mikroorganismen essen die Titanic aufExterner Link
- [13] Pilz nutzt Radioaktivität als EnergiequelleExterner Linken
- [14] Pilz nutzt Radioaktivität als EnergiequelleExterner Linken